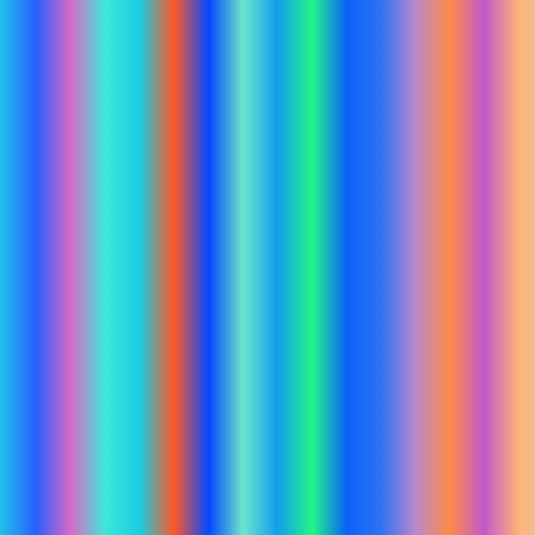Authentizität und Gemeinsinn in der Kulturpolitik. Zur Genese einer »Krise des Allgemeinen«

- 11. KupoBuko
Die wichtigsten Reformansätze der Kulturpolitik, die vor nunmehr über 50 Jahren wirksam zu werden begannen, zielten darauf, das gesellschaftliche Miteinander zu stärken und Kultur als eine umfassende Sinn- und Gestaltungsressource zu begreifen. Jenseits alter Eliten und Klassizismen sollte Kultur als das Gewöhnliche, zum Alltag Gehörende aufgefasst und ihre Stärke gerade im Verbindenden, nicht im Trennenden gesehen werden. Trennend schien das apolitische bürgerlich-idealistische Kultur- und Bildungsverständnis, verbindend Kultur als Lebensweise und kommunikative Praxis aus der gesellschaftlichen Mitte. Diese kulturpolitische Erdung – sozialutopisch aufgeladen und realpolitisch mit einem weiten Kulturbegriff ins Werk gesetzt – prägt uns bis heute; ihr folgte aber auch eine Spirale der Individualisierung und Diversifizierung. Die heute beklagte »Krise des Allgemeinen«*, in der sich die Einzelnen profilieren, während die gesamtgesellschaftliche Steuerung erodiert, ist der Reformpolitik aber bereits eingeschrieben.
Jenseits von Klasse und Schicht
Ohne das im Hintergrund fortwirkende Wirtschaftswunder wäre es wohl kaum zu dieser kulturpolitischen Prosperität in der alten Bundesrepublik gekommen. Soziologisch betrachtet handelte es sich um Auswirkungen des von Ulrich Beck beschriebenen »Fahrstuhl-Effekts«, bei dem die »Klassengesellschaft« insgesamt eine Etage höher gefahren war und auch eine Ausdifferenzierung von Individualitäten ermöglichte. In dem Maße, wie Biografien selbstreflexiv wurden (Beck 1986: 216), entstanden nicht nur differenzierte Bedürfnisse ästhetischen und politischen Ausdrucks sowie entsprechender Selbstorganisation, sondern auch neue Kulturmuster. Zwischen System und Lebenswelt ordnete Jürgen Habermas diesen nicht konfliktfreien Aufbruch ein, da es darum ging, alternative Wege der Bewältigung gesellschaftlicher Probleme zu finden, was den sozialen Nahraum aufwertete und auch zu Gegeninstitutionen führte (Habermas 1988: 580 ff.). Das Verbindende des Aufbruchs verdeckte die Zentrifugalkräfte, die ihm innewohnten.
Zumindest von der Geste her wurde die alte Gesellschaftstektonik zerschlagen. Proklamatorisch wie praktisch war dies jedoch vor allem die Zeit der großen Verteilungsgesten, des Wohlfahrtsstaates und der (Sozial-)Demokratisierung. Nicht von ungefähr gingen dabei die wichtigsten Impulse von einer sich selbst erfindenden und formierenden Zivilgesellschaft aus, die dem Kulturbereich zu völlig neuer Gestalt verhalf (etwa in Form der Entstehung freier Theater). Verlief dies anfangs subversiv, mündete es schon bald in neue Organisationsformen und Etatisierungen. Als narrative Gewissheit etablierte sich ein Bewusstsein distributiver Sendung: Kultur sei etwas grundsätzlich Gutes für alle. Die Streuweite alter ‚und‘ neuer Angebote stand gleichsam selbstverständlich für eine neue Kohäsion der Gesellschaft; das dafür auch heute noch oft bemühte Bild der »Kultur als Kit« rührt aus dieser sozialtechnologischen Setzung einer Verbindung der Menschen in und durch Vielfalt. Konflikte wurden jedoch primär durch die Erweiterung von Toleranzräumen befriedet, nicht unbedingt durch die Teilung neuer großer Schnittmengen. ‚Gefühlt‘ entstanden aber mehr Wärme und Zusammengehörigkeit, wie man es von einem Projekt der kulturellen Demokratie wohl erwarten durfte. Doch wirkte bereits der Geist des sich entfesselnden Individualismus, der mit der beginnenden Angebotsdiversifizierung korrespondierte und diese weiter verstärkte – die sozialpädagogische Geste der Zeit überdeckte ihn allerdings noch. Die realen Erträge dieses kulturpolitischen Aufbruchs stehen außer Rede, sie hat es freilich gegeben, bedürfen aber wohl neuer Einordnung.
»Wir sitzen alle neben demselben Boot. «
Grenzen kulturstaatlicher Sozialgestaltung
Während seinerzeit gesellschaftliche Modernisierung und Repolitisierung den sogenannten Dritten Sektor etablierten, der wiederum kräftige Gemeinwohlimpulse aussendete, ist es heute die neue Marktwirtschaftlichkeit, die das Bild des Kulturbetriebs prägt. Mit der Herausbildung des Kulturmanagements trug sie zur Kompensation staatlicher und kommunaler Steuerungsdefizite bei und beförderte die zweifelsohne notwendige Gewichtung des Publikums und anderer Resonanzgrößen im Kulturbereich. Eine Kluft zwischen behaupteter gesellschaftlicher Wirksamkeit und tatsächlicher Korrespondenz mit den Zielgruppen kultureller Angebote rückte dabei in den Fokus und belegte die Grenzen gesellschaftlicher Integration durch Kultur – und die Kraft des Individualismus. Dem »Fahrstuhl-Effekt« folgte inzwischen sogar eine teilweise »Rolltreppe nach unten«: »Kollektiv betrachtet, geht es für die Arbeitnehmer … wieder abwärts, und die Abstände zwischen oben und unten vergrößern sich. Vor allem die jüngeren Alterskohorten sind von der nach unten fahrenden Rolltreppe betroffen.« (Nachtwey 2016: 127) Gleichwohl setzte sich die wohlfahrtsstaatliche Erweiterungspolitik fort, differenzierte sich der Teilhabediskurs weiter aus. Folgerichtig, aber auch entgrenzend, wenn man auf die Sehnsucht nach dem Verbindenden schaut.
Als Fanal inmitten dieser angebotsorientierten Perpetuierung wirkte die plötzliche, gleichsam tabubrechende Rede von der »Ersatzveranstaltung« des Kulturstaats in der vor nunmehr zehn Jahren erschienenen Streitschrift »Der Kulturinfarkt« (Haselbach et al. 2012: 88 ff.). Der Kulturstaat – Chiffre der Sendung und Versorgung – stehe für eine »permanente politische und gesellschaftliche Kompensation« und setze hoheitliches Handeln an eine Stelle, wo es eigentlich gar nicht angezeigt sei. Der Bürger werde nicht als Handelnder, sondern als jemand imaginiert, »der durch Kunst und Kultur gerettet werden muss«. Von der Kraft der Sozialgestaltung hin zur Entmündigung könnte man die unterstellte kulturpolitische Drift pointiert fassen. Folgerichtig forderten die Autoren des »Kulturinfarkts«, die Position des ‚Individuums‘ zu stärken zulasten der Institutionen, die durch kulturstaatliches Handeln besonders geprägt und schwerfällig geworden seien (vgl. ebd.: 281).
Das historisch determinierte obrigkeitliche Kulturstaatsverständnis, das bei aller Neuinterpretation –in der jungen Bundesrepublik maßgeblich geprägt von Ernst Rudolf Huber (1958) – fortwirkte, hatte bereits Max-Emanuel Geis einflussreich dekonstruiert (Geis 1990); allerdings war mit dem Bericht der Enquete-Kommission »Kultur in Deutschland« eine deutlich modernisierte Auffassung von Kulturstaatlichkeit wieder aufgekommen, die sich vor allem aktivierend, fördernd, föderal, subsidiär und nicht zuletzt diskursiv begriff. Gefüge und Habitus machen den Staat, möchte man meinen. Gleichwohl wurden in der kulturpolitischen Debatte sowohl Begriff als auch Praxis des Kulturstaats immer wieder problematisiert (vgl. Scheytt 2008: 93 ff.; Fuchs 2011: 86 ff.). Was die Kulturinfarkt-Autoren indes spürten und jetzt offen zuspitzten, war die starke Selbstreferenzialität des Kulturbetriebs und eine fortwirkende Bekenntnishaftigkeit im Verhältnis zwischen Staat und Kultur, die mit den deutlichen Zentrifugalkräften der Individualisierung nicht mehr im Einklang standen. Mit dem »Kulturinfarkt«, so muss man heute erkennen, war die »Krise des Allgemeinen« erstmals deutlich in der Kulturpolitik evident geworden.
»Die Hoffnungen aus den 1970er Jahren, die Gesellschaft mittels einschlägiger kulturpolitischer Maßnahmen besser, weil gerechter und demokratischer machen zu können, erscheinen aus heutiger Sicht weitgehend aufgegeben«, schreibt aktuell Michael Wimmer und konzediert den Primat einer wirtschaftlichen Ausrichtung des Kulturbetriebs (Wimmer 2020: 131). In der Tat kommen die Zukunftsbilder von Kultur heute eher aus dem privatwirtschaftlichen Bereich, ist es im Gegensatz zur »zivilgesellschaftlichen Wende« der sogenannte Zweite Sektor, der das Maß vorzugeben scheint: unternehmerischer Geist versus Gemeinwohlorientierung. Armin Klein ist einer der ersten und klügsten Beobachter dieser Entwicklung und forderte früh etwa die Adaption des »Entrepreneurs« für den öffentlichen Kulturbetrieb ein. Er plädierte für eine zukunftsgerichtete Selbstverständigung der Gesellschaft, die eine »Ritualfalle« vermeidet – und machte die Besucherinteressen stark, die zweifelsohne durch Individualisierungsprozesse deutlich verändert wurden und sich von eingeübten Haltungen unterscheiden (vgl. Klein 2007: 40 ff.).
Authentizität und radikale Vielfalt
Auch Protest und Repräsentation individualisieren sich heute weiter; Oliver Nachtwey spricht gar von der Individualisierung der Bürgerrechte. Sind dies nun allein die Fliehkräfte des Neoliberalismus, also einer speziellen Praxis des Markthandelns? Wie immer ist es komplexer. Staat wie Markt haben im Kulturbereich schon länger mit Individualisierung und damit Identitätspolitik und Authentizität umzugehen. Was die Kulturpolitik nur schwer zu kanalisieren vermag und programmatisch breit diskutiert, führt im Markthandeln zu immer neuen, kleinteiligeren Attraktivitätsmärkten. Eine grundlegende Transformation berührt dabei alle Akteure, doch fällt deren Reaktionsvermögen freilich unterschiedlich aus. Das gesamte Referenzsystem befindet sich im Wandel, wir müssen uns auf globale Verflechtungen insbesondere der Märkte, Migration, Digitalität und Diversität sowie deren Wechselwirkungen einstellen – damit verbunden auf Unsicherheit, kürzere Innovationszyklen und permanente Veränderung. Krise bzw. Fragilität wird zum Strukturmerkmal, Agilität zur Überlebenshaltung.
Die Frage ist dabei, was gesellschaftliche Integration durch Kultur überhaupt bedeuten kann, wenn der Einzelne und gruppenbezogene Repräsentationen das Allgemeine zunehmend dekonstruieren und eine konstitutive radikale Vielfalt eingefordert wird: »Die Vorstellung unhinterfragbarer kultureller oder ethnischer Definitionsmacht hat ausgedient wie die Kadettenausbildung auf der ‚Gorch Fock‘. Keine Integration. Keine Heimat. Keine Leitkultur. Kein Gedächtnistheater.« (Czollek 2020: 152) Wir stehen also offenbar am Anfang gänzlich neuer Aushandlungsprozesse.
Zugleich ist die Suche nach unverfälschter Authentizität eng verknüpft mit den Aufbrüchen in eine Neue Kulturpolitik, also nicht neu, sondern ebenfalls bereits Bestandteil seinerzeit alternativen Lebens: »Etwas authentisch zu nennen und von sich zu behaupten, man verhalte sich authentisch, war eine Machtstrategie, mit der man im linksalternativen Milieu gültige legitime Verhaltensmuster auswies. (…) Individuell, kreativ, provokativ, einzigartig, unvergleichbar oder befreit zu sein – all dies wurde nicht nur zu einem Recht, sondern zur politischen Pflicht.« (Reichardt 2014: 68). Man kann in dieser Hinwendung zum Subjekt auch eine neue metaphysische Sehnsucht erkennen (vgl. Schilling 2020: 107 f.), in jedem Fall aber war sie Bestandteil gesellschaftlicher Modernisierungsprozesse. Und sie entsprang offenbar jenem Milieu, das heute die »neue Mittelklasse« mit ihrem „singularistischen Lebensstil“ (Reckwitz 2017: 273 ff.) konstituiert.
Die Parameter dieses Lebensstils setzen sich aus Authentizität, Selbstverwirklichung, kultureller Offenheit und Diversität, Lebensqualität und Kreativität zusammen und stehen, so Reckwitz, am Anfang einer neuen Klassengesellschaft. Deren Kulturpolitik gilt es heute zu formen. Dies sollte nicht affirmativ, sondern in kritischer Auseinandersetzung mit nach wie vor notwendigen Bildern gelingender Gemeinschaft erfolgen. In jedem Falle aber wird es vielgestaltig: Von der populistischen Revolte bis zum postnationalen Gesellschaftsverständnis reichen die Desintegrationsprozesse. Freiheitliche und offene Ideen von Gesellschaft bedürfen aber wohl immer auch eines Konsenses, welche Rolle der Einzelne im Resonanzraum des Kollektivs spielen kann. Ohne eine Antwort auf die Gestalt des Künftigen schließe ich mit Reckwitz: »Im Gegensatz zur Kulturpolitik des Rechtspopulismus kann es dem Kulturliberalismus nicht darum gehen, die irreduzible Heterogenität der spätmodernen Lebensformen zu negieren, sondern vielmehr darum, innerhalb dieser respektierten Heterogenität der Ethnien und Lebensstile an einem gemeinsamen Grundrahmen zu arbeiten.« (Reckwitz 2019: 299 f.). An diesem Punkt ist nicht zuletzt die Kulturpolitik gefragt, sich zu positionieren.
*Vgl. Reckwitz (2017: 429 ff.) sowie auch meinen Beitrag: »Kulturpolitik in der Krise des Allgemeinen«, in: Kulturpolitische Mitteilungen, Heft 163 (IV), 2018, S. 69–71
Literatur:
Beck, Ulrich (1986): Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag
Czollek, Max (2020): Gegenwartsbewältigung, München: Carl Hanser Verlag
Fuchs, Max (2011): Leitformeln und Slogans in der Kulturpolitik, Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften
Geis, Max-Emanuel (1990): Kulturstaat und kulturelle Freiheit. Eine Untersuchung des Kulturstaatskonzepts von Ernst Rudolf Huber aus verfassungsrechtlicher Sicht, Baden-Baden: Nomos
Habermas, Jürgen (1988): Theorie des kommunikativen Handelns, Bd. 2, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag
Haselbach, Dieter/Klein, Armin/Knüsel, Pius/Opitz, Stephan (2012): Der Kulturinfarkt. Von allem zu viel und überall das Gleiche, München: Knaus Verlag
Huber, Ernst Rudolf (1958): Zur Problematik des Kulturstaats, Tübingen: J. C. B. Mohr
Klein, Armin (2007): Der exzellente Kulturbetrieb, Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften
Nachtwey, Oliver (2016): Die Abstiegsgesellschaft. Über das Aufbegehren in der regressiven Moderne, Berlin: Suhrkamp Verlag
Reckwitz, Andreas (2017): Die Gesellschaft der Singularitäten. Zum Strukturwandel der Moderne, Berlin: Suhrkamp Verlag
Reckwitz, Andreas (2019): Das Ende der Illusionen. Politik, Ökonomie und Kultur in der Spätmoderne, Berlin: Suhrkamp Verlag
Reichardt, Sven (2014): Authentizität und Gemeinschaft. Linksalternatives Leben in den siebziger und frühen achtziger Jahren, Berlin: Suhrkamp Verlag
Scheytt, Oliver (2008): Kulturstaat Deutschland. Plädoyer für eine aktivierende Kulturpolitik, Bielefeld: transcript
Schilling, Erik (2020): Authentizität. Karriere einer Sehnsucht, München: C.H. Beck
Wimmer, Michael (2020): Das Phantom der Demokratie. Eine kleine Geschichte der österreichischen Kulturpolitik, in: Ders. (Hrsg.): Kann Kultur Politik? Kann Politik Kultur? Warum wir wieder mehr über Kulturpolitik sprechen sollten, Berlin/Boston: Walter de Gruyter GmbH, S. 123-134